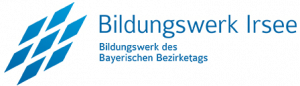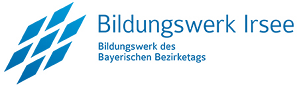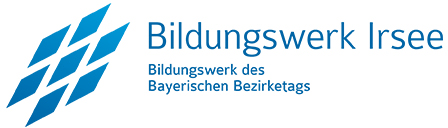Scham und Schuld
„Scham“ und ihre jüngere Schwester „Schuld“ begleiten uns das gesamte Leben lang. Im positiven wie im negativen Sinn. Deshalb sind beide (nicht nur) in der forensischen Psychiatrie ein immer wiederkehrendes Thema. Eine professionelle Beziehungsgestaltung, stationär wie ambulant, setzt voraus, sich über diese beiden grundlegenden menschlichen Gefühle bei sich und den PatientInnen klar zu werden. Sie bestimmen wesentlich, ob die Behandlung erfolgreich oder nur eine Wiederholung alter Lebenserfahrungen ist.
Es fällt auf, dass:
- in den Behandlungen, in den Lebensgeschichten der PatientInnen,
- in den (beruflichen wie privaten) Lebensgeschichten und Zeitläufen der KollegInnen und
- im Zusammenspiel zwischen den beiden Bereichen das Thema „Scham und Schuld“ immer wieder ausgespart und nicht zum erlebbaren Thema gemacht wurde.
Damit gehen viele Gelegenheiten, den Heilungsfortschritt, die Entwicklung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Identität auf beiden Seiten voranzutreiben, verloren. Das ist insofern problematisch, als Scham (und Schuld) sowohl unsere individuelle als auch kollektive Entwicklung während des gesamten Lebens formt und reguliert. Sogar die Beziehung zwischen den Generationen unterliegt ihrem Einfluss.
Zu diesem vielschichtigen Thema wird ein mehrstufiger Zugang erarbeitet:
1. Die Klärung des Begriffs „Scham“
Was ist Scham und der Unterschied zu anderen grundlegenden Gefühlen wie etwa Schuld, Freude, Trauer, Wut, Liebe, Hass?
2. Der entwicklungspsychologische Schritt
Wie entsteht Scham und welche Rolle spielt sie in der Entwicklung unserer Persönlichkeit und unserer sozialen Fähigkeiten? Welche tiefenpsychologisch-psychodynamischen, bindungs- und affektheoretischen Modelle können zur Erklärung herangezogen werden?
3. Schamsituationen und Schamkonflikte im (klinischen) Alltag
Wie sind Schamsituationen und -konflikte zu beschreiben und welche ihrer Funktionen tragen zum Gelingen menschlichen Zusammenlebens bei? Wie können Schamreaktionen „aus dem Ruder laufen“ und das menschliche Zusammenleben stören?
Es fällt auf, dass:
- in den Behandlungen, in den Lebensgeschichten der PatientInnen,
- in den (beruflichen wie privaten) Lebensgeschichten und Zeitläufen der KollegInnen und
- im Zusammenspiel zwischen den beiden Bereichen das Thema „Scham und Schuld“ immer wieder ausgespart und nicht zum erlebbaren Thema gemacht wurde.
Damit gehen viele Gelegenheiten, den Heilungsfortschritt, die Entwicklung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Identität auf beiden Seiten voranzutreiben, verloren. Das ist insofern problematisch, als Scham (und Schuld) sowohl unsere individuelle als auch kollektive Entwicklung während des gesamten Lebens formt und reguliert. Sogar die Beziehung zwischen den Generationen unterliegt ihrem Einfluss.
Zu diesem vielschichtigen Thema wird ein mehrstufiger Zugang erarbeitet:
1. Die Klärung des Begriffs „Scham“
Was ist Scham und der Unterschied zu anderen grundlegenden Gefühlen wie etwa Schuld, Freude, Trauer, Wut, Liebe, Hass?
2. Der entwicklungspsychologische Schritt
Wie entsteht Scham und welche Rolle spielt sie in der Entwicklung unserer Persönlichkeit und unserer sozialen Fähigkeiten? Welche tiefenpsychologisch-psychodynamischen, bindungs- und affektheoretischen Modelle können zur Erklärung herangezogen werden?
3. Schamsituationen und Schamkonflikte im (klinischen) Alltag
Wie sind Schamsituationen und -konflikte zu beschreiben und welche ihrer Funktionen tragen zum Gelingen menschlichen Zusammenlebens bei? Wie können Schamreaktionen „aus dem Ruder laufen“ und das menschliche Zusammenleben stören?
Themen und Inhalte
- Begriffsklärungen
- Entwicklungspsychologische Aspekte
- Unterschiedliche Modelle aus der Psychologie
- Praktische Erfahrungen und Konflikte mit Scham und Schuld
- Ansätze der Selbsterfahrung
- Entwicklungspsychologische Aspekte
- Unterschiedliche Modelle aus der Psychologie
- Praktische Erfahrungen und Konflikte mit Scham und Schuld
- Ansätze der Selbsterfahrung
Teilnehmerkreis
alle interessierten Pflegenden
Seminarnummer
2216/22
Preis
505,00 €
inkl. Unterkunft und Verpflegung
405,00 €
ohne Ü/F, inkl. Verpflegung
Ort
Kloster Seeon
Termin
23.05.2022, 12:30 Uhr -
25.05.2022, 13:00 Uhr
25.05.2022, 13:00 Uhr
Kursleitung
Thomas Auerbach
Michael Bay
Michael Bay