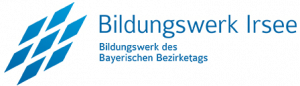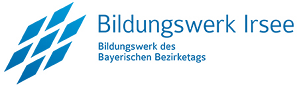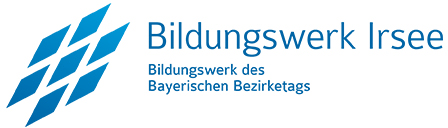Traumatisierung und Sekundärtraumatisierung im klinischen Alltag
Prävention, kollegiale Ersthilfe und Selbstfürsorge
Mitarbeitende in psychosozialen Berufsfeldern sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt, die traumatisieren können. Nach offensichtlich traumatisierenden Erlebnissen wie Gewalt und Aggression benötigen Mitarbeitende ebenso zeitnahe kollegiale Unterstützung wie bei den möglicherweise stiller verlaufenden Sekundärtraumatisierungen.
Eine Sekundärtraumatisierung ist eine Form der posttraumatischen Belastungsstörung, die z.B. bei Angehörigen helfender Berufe auftreten kann, welche mit dem Erleben, den Erinnerungen und Erzählungen von TraumapatientInnen konfrontiert sind. Obwohl Fachleute Hilfe und Trost bieten möchten, erleben sie beim sekundären Stress „ohnmächtig“ mit, dass neurobiologische und emotionale Folgen bei dem/der PatientIn weiter anhalten. Bis zu 26% der Angehörigen helfender Berufe können im Verlauf ihrer Tätigkeit an sekundärem traumatischen Stress erkranken. Werden primärer und sekundärer traumatischer Stress nicht erkannt oder bleiben unbehandelt, können sie zu einer Mitgefühlserschöpfung (compassion fatigue) und letztendlich zum Burnout führen, so dass Fachkräfte ihren Arbeitsplatz dauerhaft verlassen oder aus dem Beruf aussteigen.
Mitarbeitende brauchen Präventionsmaßnahmen. Im Erlebensfall profitieren sie von einer guten Selbstfürsorge sowie der organisierten, kollegialen Ersthilfe an ihrem Arbeitsplatz. Dies sind Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Schutzes für Mitarbeitende.
Ziele:
Die Teilnehmenden kennen
- Merkmale einer Sekundärtraumatisierung
- Maßnahmen, die nach traumatischen Vorfällen die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Mitarbeitenden langfristig erhalten können
- Vorteile kollegialer Ersthilfe
Eine Sekundärtraumatisierung ist eine Form der posttraumatischen Belastungsstörung, die z.B. bei Angehörigen helfender Berufe auftreten kann, welche mit dem Erleben, den Erinnerungen und Erzählungen von TraumapatientInnen konfrontiert sind. Obwohl Fachleute Hilfe und Trost bieten möchten, erleben sie beim sekundären Stress „ohnmächtig“ mit, dass neurobiologische und emotionale Folgen bei dem/der PatientIn weiter anhalten. Bis zu 26% der Angehörigen helfender Berufe können im Verlauf ihrer Tätigkeit an sekundärem traumatischen Stress erkranken. Werden primärer und sekundärer traumatischer Stress nicht erkannt oder bleiben unbehandelt, können sie zu einer Mitgefühlserschöpfung (compassion fatigue) und letztendlich zum Burnout führen, so dass Fachkräfte ihren Arbeitsplatz dauerhaft verlassen oder aus dem Beruf aussteigen.
Mitarbeitende brauchen Präventionsmaßnahmen. Im Erlebensfall profitieren sie von einer guten Selbstfürsorge sowie der organisierten, kollegialen Ersthilfe an ihrem Arbeitsplatz. Dies sind Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Schutzes für Mitarbeitende.
Ziele:
Die Teilnehmenden kennen
- Merkmale einer Sekundärtraumatisierung
- Maßnahmen, die nach traumatischen Vorfällen die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Mitarbeitenden langfristig erhalten können
- Vorteile kollegialer Ersthilfe
Themen und Inhalte
- Krise, Trauma, Sekundärtraumatisierung, posttraumat. Verbitterungsstörung
- Merkmale und Folgen der Sekundärtraumatisierung
- Selbsthilfe (Don’ts and Do’s)
- Interventionen der kollegialen Ersthilfe zur Stressverarbeitung (Don’ts and Do’s)
- Mental Health First Aid (MHFA)
- Nachbesprechungs-Varianten
- Merkmale und Folgen der Sekundärtraumatisierung
- Selbsthilfe (Don’ts and Do’s)
- Interventionen der kollegialen Ersthilfe zur Stressverarbeitung (Don’ts and Do’s)
- Mental Health First Aid (MHFA)
- Nachbesprechungs-Varianten
Teilnehmerkreis
Mitarbeitende psychiatrischer und psychosomatischer Behandlungen, Stations- und Pflegedienstleitungen
Seminarnummer
2737/24
Preis
595,00 €
inkl. Unterkunft und Verpflegung
495,00 €
inkl. Verpflegung
Ort
Kloster Irsee
Termin
13.03.2024, 12:30 Uhr -
15.03.2024, 13:00 Uhr
15.03.2024, 13:00 Uhr
Kursleitung
Ahrens, Ruth C.